Notwendige Anmerkungen zum betrieblich nicht notwendigen Vermögen
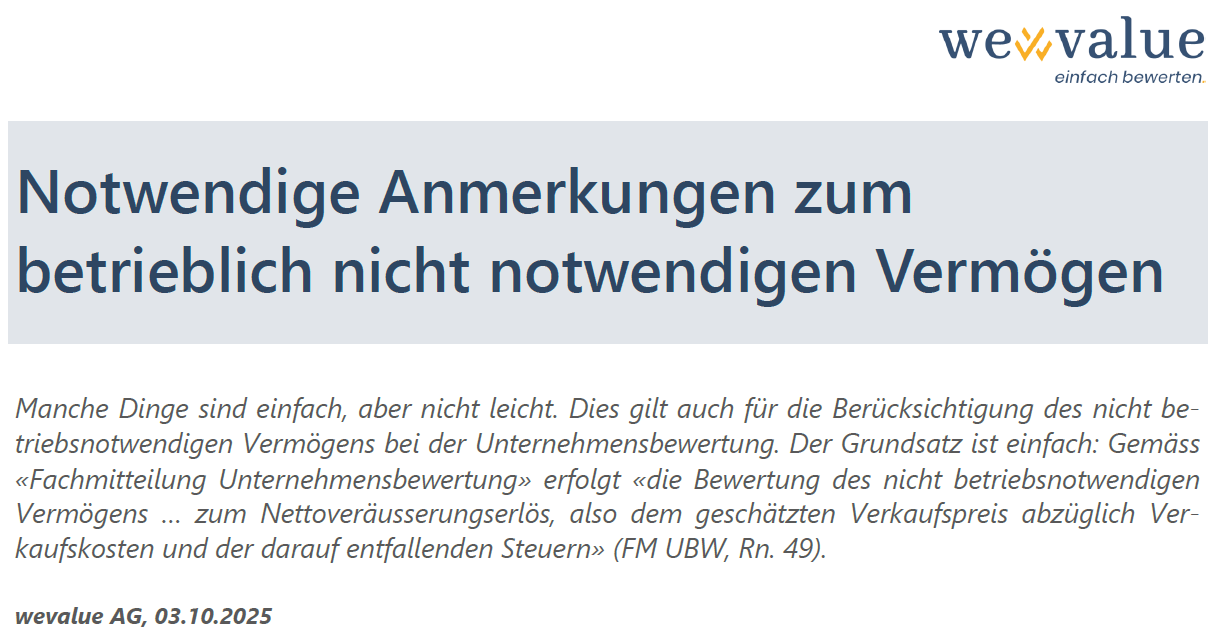
Manche Dinge sind einfach, aber nicht leicht. Dies gilt auch für die Berücksichtigung des nicht betriebsnotwendigen Vermögens bei der Unternehmensbewertung. Der Grundsatz ist einfach: Gemäss «Fachmitteilung Unternehmensbewertung» erfolgt «die Bewertung des nicht betriebsnotwendigen Vermögens … zum Nettoveräusserungserlös, also dem geschätzten Verkaufspreis abzüglich Verkaufskosten und der darauf entfallenden Steuern» (FM UBW, Rn. 49).
Klassisches Beispiel oder Graubereich?
Bereits die Abgrenzung des nicht betriebsnotwendigen Vermögens ist in der Praxis nicht immer einfach. Während Kunstgegenstände, Yachten und erlesene Spirituosen schnell klassifiziert sind, wird es bei vermieteten Immobilien, Wertschriften und Liquidität unübersichtlich.
Das Paradoxon: notwendiges, aber nicht betriebliches Vermögen
Wenig beachtet wird in diesem Zusammenhang, dass es auch notwendiges, nicht betriebliches Vermögen gibt. So ist der Kauf oder Verkauf eines Einzelunternehmens naturgemäss stets ein Asset Deal. Nicht alle Vermögenswerte und Schulden können ohne weiteres übertragen werden. So ist der Verkauf von Debitoren und Kreditoren, Bankguthaben und -verbindlichkeiten, laufenden Leasing- und Mietverträge etc. in der Regel nur nach Zustimmung der entsprechenden Gegenparteien rechtlich möglich. Damit wird die Transaktion schwerfällig, langwierig und vor allem publik. Daher bleiben die genannten Vermögenswerte und Schulden häufig beim Veräusserer und faktisch werden nur das Anlagevermögen und die Vorräte veräussert.
Die «leere Batterie» bei der DCF-Bewertung
Bei einer DCF-Bewertung ist darauf zu achten, dass die aus rechtlichen Gründen zurückbehaltenen Vermögenswerte und Schulden wirtschaftlich notwendiger Bestandteil der integrierten Planung und des Unternehmenswertes sind: Das Unternehmen wird «aufgeladen» mit Debitoren, Kreditoren und Liquidität bewertet, tatsächlich ist die Batterie jedoch leer. Richtigerweise vermindert dieses notwendige, nicht betriebliche Vermögen den Unternehmenswert, da diese Lücke (im Falle eines positiven Saldos) vom Übernehmer geschlossen werden muss.
Ausschüttungspotenzial als Bewertungsfalle
Noch ein Hinweis zur Bewertung des betriebsnotwendigen Vermögens bei Kapitalgesellschaften. Die separate Bewertung unterstellt, dass dieses Vermögen den Eigentümern auch «zufliessen» muss, was bei Kapitalgesellschaften nur in Form einer Dividende geschehen kann. Dazu muss nach einem (gedachten) Verkauf ausreichend ausschüttungsfähiges Eigenkapital zur Verfügung stehen.
Da nach einem (gedachten) Verkauf nur der Gewinn nach betrieblichen Steuern zur Verfügung steht, sind nicht nur die Verkehrswerte relevant, sondern auch die Buchwerte, um so die auf den Veräusserungsgewinn entfallenden betrieblichen Steuern, die effektive Mehrung des Eigenkapitals und damit das Ausschüttungspotential ermitteln zu können.
Ist die Ausschüttung liquiditätsmässig möglich, aber rechtlich nicht zulässig (ist mit anderen Worten das Geld da, man bekommt es aber nicht aus der Firma…), muss eine Annahme zur Verwendung des fiktiven Veräusserungserlöses getroffen werden. Naheliegend ist die auch bei der Ausschüttungsplanung angenommene „kapitalwertneutrale Wiederanlage“. Mit anderen Worten wird die Anlage der Gelder zu den Kapitalkosten unterstellt. Mit dieser Annahme (die allerdings auch im Gutachten ausdrücklich so benannt werden sollte) kann auch bei einer zu dünnen Kapitaldecke eine fiktive Ausschüttung des Veräusserungserlöses nach Steuern modelliert werden.
Ob und inwieweit noch persönliche Steuern auf diese fiktiven Ausschüttungen berücksichtigt werden, ist letztlich Verhandlungssache. Die Schweizer Bewertungspraxis bewertet ohne persönliche Steuern. Ob dies bei der Diskussion um den Preis berücksichtigt werden kann und soll, ist eine andere Frage.

